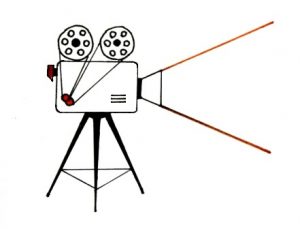
Jeder wird irgendwann über die magischen Worte „Show, don’t tell“ gestolpert sein, wenn er sich intensiv mit dem Handwerkszeug des Schriftstellers beschäftigt hat (und wer bereits mit Lektorinnen und Lektoren zusammengearbeitet hat, mit Sicherheit auch). Doch was hat es mit dieser merkwürdigen Floskel auf sich?
Grob zusammengefasst geht es darum, allein durch Worte so starke und treffende Bilder im Kopf des Lesers zu erzeugen, dass die erzählte Handlung wie ein Kinofilm vor dem geistigen Auge abläuft. Manch einem geht das leicht von der Hand, andere verfolgt das verflixte „Beschreib es nicht, zeige es“ noch im Schlaf.
Dabei ist die Umsetzung einer atmosphärischen, emotionalen Erzählweise an sich denkbar einfach: Lassen Sie Ihre Figuren riechen, hören, fühlen, schmecken und lassen Sie Ihre Figuren diese Sinneserfahrungen am besten gleich selbst erzählen. Finden Sie Vergleiche (vielleicht auch schräge) für das, was Ihren Figuren widerfährt und was sie wahrnehmen. Beschreiben Sie beispielsweise den Geruch von frischer Kartoffelsuppe oder das Geräusch ächzender Bäume im Wind mit ungewöhnlichen Worten; erzählen Sie, dass Ihre Protagonistin sich an etwas erinnert, ohne das Wort „erinnern“ zu benutzen; beschreiben Sie einen ängstlichen Menschen, ohne dass das Wort „ängstlich“ im Text vorkommt. Erst dann wird die Geschichte lebendig und bunt wie ein Kinofilm.
Ein Beispiel gefällig?
„Klara saß auf der Bank im Park. Sie aß ein Butterbrot und hörte den Vögeln zu, dabei dachte sie an ihre Großmutter.“
Mal Hand aufs Herz: Wie viel Kopfkino ist da gerade entstanden? Die beiden Sätze erzählen (tell) einen Sachverhalt, nicht mehr und nicht weniger. Würde die Situation gezeigt (show), könnte die Szene zum Beispiel so beginnen:
„Klara blinzelte in die Sonne. Endlich hatten es die ersten warmen Strahlen auch nach Norddeutschland geschafft und zauberten ein zartgrünes Farbspiel auf die Baumwipfel. Mit lautem „Ziwitt-ziiiep-zipzipzipzip“ verschwand der Schatten eines Vogels in der hohen Buche jenseits der Wiese. Ob er sich über ein Krümchen von ihrem Brot freuen würde? Klara holte das knisternde Päckchen aus ihrer Umhängetasche und wickelte die Brotscheiben aus. Reflexartig hob sie das zusammengeklappte Brot an die Nase, schnupperte daran und lehnte sich mit einem tiefen Seufzer auf der Parkbank zurück. Genau so hatten die Butterbrote ihrer Kindheit gerochen, als sie noch mit ihrer Großmutter zu langen Spaziergängen in die Natur aufgebrochen war.“
Haben Sie Klara auf der Parkbank gesehen? Und haben Sie jetzt vielleicht sogar den Geruch von frischem Brot mit guter Landbutter in der Nase? Natürlich sollte man sich nicht in Details verlieren, es geht nicht darum, in der Schilderung der Natur Adalbert Stifter Konkurrenz zu machen. Beschreiben Sie eine Szene so, dass ein Maler ein Bild davon malen könnte – erzählen Sie nicht zu viel und nicht zu wenig und regen Sie mit Ihren Worten die Fantasie der Leser an.
So wie in diesem Beispiel die Umgebung der Protagonistin plastischer wurde, kann man natürlich auch Emotionen, Geisteshaltungen und vieles mehr im Text erlebbar machen. Denken Sie einmal an jemanden, der sich erschreckt, und schreiben Sie nicht: „Er erschrak furchtbar“. Überlegen Sie stattdessen, wie es sich anfühlt, wenn Sie einen dunklen Hausflur betreten und plötzlich Nachbars Katze zwischen Ihren Beinen hindurch nach draußen huscht. Versetzen Sie sich in Ihre Romanfiguren hinein und geben Sie wieder, was diese erleben.
Ein wunderbarer Ratgeber zum Thema
Noch viel mehr Beispiele für lebendiges Erzählen sind übrigens in dem handlichen Büchlein „Show, don’t tell: Schreiben fürs Kopfkino“ von Simone Harland nachzulesen, das sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt und das ich allen Autorinnen und Autoren wärmstens empfehlen möchte.
Die erfahrene Autorin (und Lektorin) mit einem wunderbaren Gespür für das Wesentliche führt darin auf knapp 55 Seiten die verschiedenen Spielarten des „Show, don’t tell“ vor: Wie beschreibt man eine Person, die müde ist? Wie kann eine Landschaftsbeschreibung so spannend sein, dass die Leser die Umgebung der Erzählung nicht nur kennen, sondern sich in sie hineinversetzt fühlen? Wie erzeuge ich Spannung, die unter die Haut geht? Und wie kann ich innerhalb eines Dialogs mit ganz einfachen Mitteln die handelnden Personen charakterisieren – und zwar ohne all die „sagte sie empört/entgegnete er wütend/fragte sie ratlos“ usw.?
Am Ende eines jeden Kapitels gibt es Anregungen für Schreibübungen, die so richtig Lust aufs Fabulieren machen, denn die Autorin schildert das Handwerkszeug des „Show, don’t tell“ so klar und verständlich, dass man die Tipps einfach sofort umsetzen MUSS. Wen würde es nicht in der Feder jucken, wenn er eine Schreibaufgabe wie diese bekommt: „Zeigen Sie, dass eine Person geizig ist, ohne dies ausdrücklich zu erwähnen. Beschreiben Sie eine ihrer Handlungen, die beweist, dass sie geizig ist.“
Bei all der Begeisterung für das „Zeigen“, darf allerdings nicht vergessen werden, dass auch das „Erzählen“ seine Berechtigung hat. Manchmal ist Verknappung notwendig, damit die nächste Szene wieder in aller Ausführlichkeit „gezeigt“ werden kann. Hier die Balance zu finden, ist nicht immer leicht, aber auch dafür hält Simone Harland hervorragende Tipps bereit. Und das Beste: Der kleine Ratgeber kostet weniger als die Hälfte einer Kinokarte, regt aber zu Kopfkino für viele, viele Stunden an!
© Christiane Saathoff